– öffentlich –
Dossier über Dieter Lenzen
Bewerber um das Präsidentenamt an der Universität Hamburg
November 2009
Inhalt:
1. „Herrschaft des Besten“?
Einleitung
2. Ein Offizier des Kapitals
- „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM)
o Grundsätze
o Zu Studiengebühren
o Zu Humankapital
- Aktionsrat Bildung
3. Dressur statt Bildung – der „Pädagoge“
- Bildung als Standortfaktor
- Geschichtsrevisionismus
- Disziplin, Ordnung, Autorität
- Schulpolitik
4. ... als Hochschuldidakt
- von der Ungleichwertigkeit der Menschen
- Auswahlverfahren, Ba/Ma, Credit- und Malus-Points
- Sozialdarwin
5. Der Wissenschaftspolitiker und die Forschungsuniversität
- Profilbildung durch Ökonomisierung
- Rüstungsforschung statt Sozialkritik
- Ein Hohelied auf Cluster
6. Die Diktatur des Managements
- Berufungspolitik
- Anti-Links
- Maulkorb-Erlaß
- Studentische Mitbestimmung nicht gewünscht
V.i.S.d.P.: Golnar Sepehrnia, Olaf Walther, Christian Sauerbeck - BAE!
„Herrschaft des Besten“?
Der Bewerber für das Präsidentenamt an der Universität Hamburg
„Die großen Transformationsereignisse der letzten fünfzehn
Jahre von der sogenannten Wende bis zu maßlosen Millenniumsfeiern haben
bei breiten Kreisen der Bevölkerung einen Suff der Gegenwärtlichkeit
hinterlassen, der nicht einmal Platz für eine Zukunftssorge auf mittlerem
Niveau läßt.“
Dieter Lenzen, „Planungsrationalität, Kultur und Moral“, Rede
zum Amtsantritt als Präsident der FU Berlin, 27. Juni 2003.
„Die Massen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick zu
verdienen: einmal als verschwimmende Kopien der großen Männer, auf
schlechtem Papier und mit abgenutzten Platten hergestellt, sodann als Widerstand
gegen die Großen und endlich als Werkzeuge der Großen; im Übrigen
hole sie der Teufel und die Statistik!“
Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, Zweites Stück,
Kapitel 9, 1873.
 Prof.
Dr. Dieter Lenzen, derzeit umstrittener Präsident der „Freien“
Universität Berlin, ist Bewerber für das Präsidentenamt an der
Universität Hamburg. Er vertritt eine reaktionäre Kritik an der derzeitigen
Gesellschaft. Weltanschaulich steht er in liberal-konservativer Tradition und
baut auf die „Grundwerte“ Ordnung (als Abwehr sozialer Befreiung),
Differenz (Ungleichheit als konstitutives menschliches Merkmal), und elitäre
Distanz (als Grundlage herrschaftlichen Eingreifens zur Verteidigung gesellschaftlicher/individueller
Privilegien). Diese Konzeption ist sowohl ideologisch, politisch als auch in
der (kulturellen) Praxis seiner Hochschulleitung nachweisbar.
Prof.
Dr. Dieter Lenzen, derzeit umstrittener Präsident der „Freien“
Universität Berlin, ist Bewerber für das Präsidentenamt an der
Universität Hamburg. Er vertritt eine reaktionäre Kritik an der derzeitigen
Gesellschaft. Weltanschaulich steht er in liberal-konservativer Tradition und
baut auf die „Grundwerte“ Ordnung (als Abwehr sozialer Befreiung),
Differenz (Ungleichheit als konstitutives menschliches Merkmal), und elitäre
Distanz (als Grundlage herrschaftlichen Eingreifens zur Verteidigung gesellschaftlicher/individueller
Privilegien). Diese Konzeption ist sowohl ideologisch, politisch als auch in
der (kulturellen) Praxis seiner Hochschulleitung nachweisbar.
Der berliner CDU galt er zeitweise als möglicher Kandidat für das
Amt des Regierenden Bürgermeisters.
Seine Nominierung für das Präsidentenamt durch den Hochschulrat käme
einer Kriegserklärung an die Universität und ihre Mitglieder gleich.
Sie wäre sowohl auf die gesellschaftlich notwendige Verwirklichung des
universitären Leitbildes als auch wegen der neueren Auseinandersetzung
für eine Demokratisierung und kooperative Entwicklung der Universität
eine ebenso reaktive wie riskante Maßnahme.
Nachfolgend soll diese Einschätzung nachvollziehbar gemacht werden:
Ein Offizier des Kapitals
Der Bewerber ist vielfältig für die ideologische und bildungspolitische
Durchsetzung der partikularen Interessen großer Unternehmen engagiert.
Er ist Fördermitglied und Berater der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft"
(INSM). Diese ist vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und all deren regionalen
Teilverbänden – versammelt die Automobil- und Rüstungsindustrie
– ins Leben gerufenen und wird jährlich mit offiziell 8,8 Mio Euro
finanziert. Es handelt sich um einen neoliberalen „think tank“,
der nachweislich und ohne jeden Hehl im Sinne seiner Erfinder Medienmanipulation
betreibt.
Die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ verfolgt ideologisch die konkurrenzgeleitete Zerstörung sozialstaatlicher Errungenschaften. Wissenschaftspolitisch propagiert sie insbesondere Studiengebühren als Maßnahme zur Herstellung von „Gerechtigkeit“ zwischen vermeintlich substantiell privilegierten Akademikern und von diesen angeblich ausgenutzten Fachaberbeitern. Nicht Mechaniker und Akademiker sind beide Mittel zum Zweck der unternehmerischen Profitsteigerung (bzw. der staatlichen und ideologischen Organisation und Absicherung dieses Prozesses), sondern der Mechaniker werde durch den Akademiker ausgebeutet.
Für den Standort sei der Mensch zu vermarkten. Mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige warb INSM mit einer anti-humanen Reklame: „Unser teuerster Exportartikel“. Zusehen ist ein menschliches Gehirn in einem durchsichtigen Gefrierbeutel. Über dem Scan-Code ist zu lesen: „Feinstes Akademikergehirn, Gewicht: 1375g, Haltbar bis: 05/2040, Herkunftsland Deutschland“. Ungehemmt wird auf der Würde des Menschen herumgetrampelt.

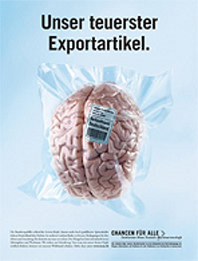
Der Mensch zynisch zerlegt und verpackt als Ware, zum Export bereit –
oder doch besser zu animieren, sich zur kannibalisch-profitablen Verwertung
am „Standort Deutschland“ bereit zu stellen.
Dieter Lenzen wirbt im Dienste dieses „think tanks“ für arbeitsmarktkonformes,
„leistungsorientiertes“ und konkurrenzverschärfendes Lernen
in vorwiegend kulturell selektiven Bildungsinstitutionen.
Darüber hinaus ist er Vorstand des „Aktionsrats Bildung“ der
bayrischen Wirtschaft (Metall- und Elektro-Industrie). Der „Aktionsrat“
hat den Auftrag für eine kapitalverwertungsgerechte Bildungsdeform in Land
und Bund vermeintlich wissenschaftlich untersetzte „Studien“ zu
verbreiten. In deren Auftrag gab Lenzen 2003 die Studie „Bildung neu denken!
Das Zukunftsprojekt“ heraus. Hierin wird das derzeitige Bildungssystem
mit neoliberalen Behauptungen „kritisiert“. Das Bildungssystem müsse
entstaatlicht, Schule auf die Förderung von „Leistung“ und
„Eigenverantwortung“ und institutionelles Marktbestehen (rsp. -versagen)
zugerichtet werden. Die „Leistungselite“ müsse bessere „Rekrutierungsbedingungen“
haben und vergrößert werden, die „leistungsschwache“
Mehrheit sei zielgerichteter auf Arbeitsmarkterfordernisse zuzurichten.
[Quelle: http://www.romanherzoginstitut.de/uploads/tx_mspublication/Lenzen-Studie_Bildung_neu_denken.pdf)]
Unverholen betreibt der vermeintliche Wissenschaftler Lenzen also die gesellschaftliche
Spaltung in „Elite“ und „Masse“ im Auftrag der Eigentümer,
Aktionäre und Vorstände der deutschen Schlüsselindustrien. Als
Lobbyist zur profitbringenden Negation von Menschenwürde, politischer Gleichheit,
freier Entfaltung der Persönlichkeit, Wissenschaftsfreiheit und Sozialstaatlichkeit
bewegt er sich höchstens scheinbar im Rahmen des Grundgesetzes.
Unvereinbar ist dies auch mit dem Leitbild der Universität Hamburg (1998):
„Wissenschaftliche Freiheit in gesellschaftlicher Verantwortung: Die Mitglieder der Universität wollen die universitären Aufgaben in der Verbindung von Forschung und Lehre, Bildung und Ausbildung in wissenschaftlicher Unabhängigkeit erfüllen. Sie wollen zur Entwicklung einer humanen, demokratischen und gerechten Gesellschaft beitragen und Frauen und Männern gleichen Zugang zu Bildung und Wissenschaft eröffnen.“
Dressur statt Bildung – Der „Pädagoge“
Herr Lenzen geht davon aus, daß „Deutschland“ sich in der „globalisierten Welt“ als bester Wirtschaftsstandort auf Kosten und zu Lasten der Mehrheit der Weltbevölkerung durchsetzen muß:
„Wieder einmal kommt der Bildungspolitik die Schlüsselrolle zu, an die Stelle des Sputnik-Schocks ist der Pisa-Schock getreten, erneut wird nach „Bildungsreserven“ gesucht, und erneut besteht die Gefahr, dass gesellschaftspolitische Debatten die eigentliche Kernfrage überlagern: Wie wird es möglich sein, Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft schon in Familie und Schule zu kultivieren, die Freude am Wettbewerb nicht zu diskriminieren, eine möglichst große und tüchtige Leistungselite zu fördern, Dienstleistungsberufe herauszubilden und die bildungsfernen Schichten zu aktivieren?“
[http://www.wirtschaftundschule.de/WUS/homepage/Aktuell/Bildungspolitik/Mehr_lernen__was_sonst_.html?version=w]
Um diese gesellschaftlichen Widersprüche reaktionär beantworten zu können, müssen die humanistischen Lehren aus dem Faschismus als irrationale Reflexe denunziert werden:
„Die >Bildungsreform< wurde indessen von einem ganz anderen Thema überlagert: der Kritik an der >autoritären<, >spätkapitalistischen< Gesellschaft. Die Aufmerksamkeit der Schulen wurde auf gesellschaftliche Lehrplaninhalte gerichtet, >soziales Lernen< rückte in den Mittelpunkt der Aktivitäten. Der deutsche Glaube daran war unverrückbar, dass staatliche Erziehung entweder zum Sozialismus in der DDR oder zum kritischen Staatsbürger in der Bundesrepublik eine Wiederholung der Gräuel des Naziregimes verhindern könnte. Weil die Durchsetzung von Leistungsstandards aber als ein besonderes Beispiel für autoritäres Unterrichten gehalten wurde, diskriminierte man die Prinzipien der Leistung, der Anstrengung oder gar des Wettbewerbs nicht selten als solche.“ (ebd.)
Jetzt sei dieser Irrtum auszuräumen:
„Eine Bildungsrevolution wird nur gelingen, wenn wir, die Bürger in allen Schichten, begreifen: Bildung heißt in erster Linie Selbstdisziplin, Anstrengung, Verantwortung, Fairness gegenüber den anderen und Respekt gegenüber den Erziehenden. Das heißt schließlich für und, wenn wir Eltern oder Großeltern sind: nicht nur Ja zu sagen zu allem, was unsere Kinder tun, nicht wegzuschauen, wenn sie sich falsch verhalten, sondern auch Nein zu sagen und den richtigen Weg zu zeigen.“ (ebd.)
Das christlich-konservative Anti-Reform-Konzept für „Mut zur Erziehung“
(Konrad-Adenauer-Stiftung 1978) ist hier deutlich wiederzuerkennen. Wir empfehlen
Herrn Lenzen den Besuch des Kinofilms das weiße Band.
Nur leicht modifiziert wendet sich Lenzen gegen integrative Schulbildung, setzt
sich für ein Zwei-Säulen-System zur privilegierten Qualifikation einer
gymnasialen Elite und einer arbeitsmarkt-relevanten Mobilisierung von Bildungsfernen
in Stadtteilschulen. Schulen seien zudem wie „Privatbetriebe“ zu
„führen“ und durch Ressourcenanreize (auch: Bildungsgutscheine)
oder fiskalische Strafen am Markt zu fördern oder zu schließen. (Quelle:
http://www.zeit.de/2007/11/C-Gespraech-Lenzen)
Was hier als „Bildung“ dargestellt wird, dient somit einzig der
verzichts- und disziplin-beladenen Erziehung zur individuellen Aufopferung für
die Standortgemeinschaft. Das schließt die Existenz und Förderung
einer privilegierten „Leistungselite“ ein und ist somit die anti-aufklärerische
Verneinung von gesellschaftlicher Egalität, Solidarität und entfaltungsfördernder
Kooperation.
… als Hochschuldidakt:
„Das bedeutet zu versuchen, Benachteiligungen auszugleichen, die unverschuldet sind, ohne Förderung mit Versorgung zu verwechseln, ohne multikulturelle Partys bereits für eine Sensibilisierung gegenüber der Aura des Fremden zu halten und ohne zu glauben, dass geringe Leitungsanforderungen an unseren Studierenden in deren Sinne wären. Sie werden heute nicht einmal von diesen mehr erwünscht. Richtigerweise muss deshalb das Fördern mit dem Fordern, die Offenheit für das andere mit der Einhaltung unserer Regeln des Lebens und die Leistungserwartung mit der Bereitschaft verbunden sein, denen, die etwas leisten sollen, auch die Möglichkeit dazu zugeben“ (Dieter Lenzen: Amtsantritt als Präsident der FU Berlin, Mai 2003)
Menschen sind – so Lenzen – also je nach „Leistung“
unterschiedlich viel wert. Förderung und Nachteilsausgleich seien nur Erlaubt,
wenn sie Aussicht auf ökonomisch verwertbare Instrumentalisierung des Menschen
hätten. Eine straffe Selektion durch willkürliche Auswahlverfahren
(„Mixtur“ aus „Auswahlgesprächen“ und „Multiple-Choice“),
durch die prüfungsbeladenen BA/MA-Studiengänge und eine enge Auslese
im Übergang zum (zweisemestrigen) Master nach einem achtsemestrigen Bachelor
entsprechen seinen Vorstellungen. Es nimmt deshalb nicht Wunder, daß die
FU Berlin bei der Einführung von Bachelor/ Master-Studiengängen zusätzlich
zu den üblichen Credit-Points auch noch Malus-Punkte in ihren Prüfungsordnungen
verankert hat, die den Leitungsdruck ein weiteres Mal steigern.
Bildungspolitisch ist der Bewerber ein Vertreter des sozialdarwinistischen „survival
of the fittest“. Das wird nicht im geringsten dadurch gemildert, daß
er zum besseren Zugriff der Arbeitgeber auf die qualifizierte „Ressource
Mensch“ für die Öffnung der Hochschulen plädiert. Tatsächlich
sinken auch an der FU die Studierendenzahlen.
Die humanistische Alternative: „Bildung mündiger Menschen: Ihren Bildungsauftrag sieht die Universität in der Entwicklung von Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit und der Fähigkeit zu argumentativer Verständigung auf wissenschaftlicher Grundlage. Für alle Menschen will sie ein Ort lebenslangen Lernens sein und ein öffentlicher Raum der kulturellen, sozialen und politischen Auseinandersetzung.“ (Leitbild der Universität Hamburg, 1998)
Der Wissenschaftspolitiker und die „Forschungsuniversität“
Der Kriegslogik der Standortpolitik folgend, hat Wissenschaftspolitik für den Bewerber Lenzen vor allem Forschungsförderung nach privat-ökonomischen Kriterien zu sein. Auch die von ihm geforderte Erhöhung des Wissenschaftsetats und Ausdehnung der Hochschulautonomie (gegenüber dem demokratisch legitimierten staatlichen Stellen, nicht Drittmittelgebern und privater „Partner“) dient einzig diesem Zweck. Die Hervorbringung von „Forschungs-Produkten“ und Absolvent_inn_en ist allein an Markterfolgen auszurichten. Nur in diesem engen Rahmen haben die Entwicklung „kritischer Kompetenz“, die Gleichstellungspolitik oder die Nachwuchsförderung ihren Platz:
„Ich erwarte, daß wir gemeinsam in diesem Prozeß auf ein Set von höchstens einem Dutzend großer Schwerpunkte oder Cluster gelangen, zu denen Fächer, Institute, Fachbereiche jeweils originäre Beiträge leisten, so daß diese Clusterstruktur zu dem führt, was man heute als Alleinstellungsmerkmal bezeichnet.“ (Dieter Lenzen, Rede anläßlich der Wahl ins Präsidentenamt der FU Berlin, Mai 2003.)
Die Wissenschaftscluster – nahe verwandt dem in Hamburg längst politisch
beerdigten McKinsey/Dohnanyi-Plan der Forschungsdepartments – dienen der
Separierung der Forschung von der (niederen) Lehre und der institutionellen
Entkopplung von (teil-)demokratischen akademischen Selbstverwaltungsstrukturen.
(vgl. Bodo Zeuner, „ Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang?,
Abschiedsvorlesung, 2007.) Die Aquirierung von Drittmitteln und Sponsoringgeldern
wird als Befreiung aus der staatlichen Gängelung und Entlassung in die
Marktfreiheit abgefeiert.
Bei gleichzeitiger staatlicher Unterfinanzierung hat dies in extremen Ausmaß
zur Abwicklung kritischer Wissenschaftsanteile und zur Auslieferung aller Fächergruppen
an die Erwartungen der Geldgeber geführt. Im Jahresbericht der Informationsstelle
Militarisierung e.V. (IMI) von 2009 ist deshalb auch eine Beteiligung an Rüstungs-
und „Sicherheits“-Relevanter Forschung nachgewiesen. (Sarah Nagel,
Imi-Studie, Nr. 07/2009)
Lenzen: „Ich halte dieses für den einzigen Weg, angesichts der sich verschärfenden ökonomischen und politischen Situation in dieser Stadt die Freie Universität als Universität zu behalten, weiter zu entwickeln und ihr eine unverwechselbare Identität zu geben. Diese Cluster orientieren sich an mittelfristigen, vorhersagbaren, gesellschaftlichen Erwartungen an Universitäten. Es sind dieses Erwartungen, die im Zusammenhang mit Technologieentwicklungen stehen, mit einem intellektuell hochrangigen Beratungsbedarf vom politischen System bis hin zur Judikative und mit der klassischen Aufgabe europäischer Universitäten bei der Rekonstruktion kultureller Tradition und der Ausdifferenzierung der Kultur.“ (Dieter Lenzen, Antrittsrede, Mai 2003)
Die Universität als konforme Dienerin privat-ökonomischer Interessen
und politischer sowie kultureller Herrschaftssicherung – mit dieser Zielsetzung
wird die intellektuelle Selbstentleibung einer Zentraleinrichtung gesellschaftlicher
Aufklärung betrieben.
Wahrlich: Eine Exzellenz-Universität!
„Freie Forschung und wissenschaftliche Lehre: Durch ihre Forschung trägt die Universität Hamburg zur freien Entwicklung der Wissenschaft bei, durch Lehre und Studium zur Verwirklichung des Rechtes auf wissenschaftliche Bildung.“ (Leitbild)
Die Diktatur des Managers
Der Widerspruch zwischen einerseits den Forschungs-Ufos und andererseits gesetzlich gesicherter Mitbestimmung auf Basis der historisch begründeten Fächer- und Selbstverwaltungsstruktur wird von Lenzen diktatorisch „aufgelöst“. Wann immer ein Konflikt droht, werden die Gremien schlicht vermittels präsidialer „Richtlinienkompetenz“ ausgeschaltet oder auf anderen Wegen delegitimiert und umgangen. Beispiele:
„LENZEN: Wenn man einen Wettbewerb zwischen den Universitäten wünscht, dann gehört natürlich dazu, dass diejenigen, die für die Institution verantwortlich sind, auch die Personalpolitik machen können. In erster Linie die Fachleute aus den Fachbereichen. Die gesamtstrategische Steuerung muss in die Hände der Hochschulleitungen, also der Dekanate und Präsidien, gebracht werden. Denn die Gesamtlinie einer Uni kann nicht von einer Berufungskommission überblickt werden. Kein Mensch käme auf die Idee, die Bereichsleiter bei Mercedes durch den Wirtschaftsminister oder die Belegschaft auswählen zu lassen. Oder nehmen wir den Exzellenzwettbewerb. Der wird zu einer einzigartigen Verschiebung von Schwerpunkten in den Universitäten führen. Deshalb haben DFG und Wissenschaftsrat den Hochschulleitungen als Antragstellern eine besondere Rolle zugewiesen.“ (Tagesspiegel, 12.09.2005, S. 25)
So wird jede demokratische Legitimation der Präsidentschaft – ob
durch eine zumindest parlamentarisch gestützte Behörde oder durch
die Wahl durch Hochschulmitglieder – rundheraus abgelehnt. Aus dieser
Sicht hielt der Präsident der FU Berlin es auch für angebracht, in
einem bemerkenswerten Willkürakt die Berufung des durch sämtliche
zuständigen Gremien einhellig unterstützten Nordamerikanisten Albert
Scharenberg auf eine Junior-Professur am J.F.Kennedy-Institut der FU zu verweigern.
Scharenberg ist Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale
Politik“ und Mitglied im Kuratorium der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch
auf Besetzungsvorschläge aus der Universität für weniger exponierte
Stellen gab es vergleichbare politisch motivierte Ablehnung.
Wer dennoch nicht an politische Zensur eines absoluten Uni-Präsidenten
glauben will, möge sich davon überzeugen lassen, das Prof. Peter Grottian
die Beteiligung an einer „Langen Nacht des Wissens“ wegen zu erwartender
kritischer Äußerungen zur bildungspolitischen Situation untersagt
wurde. Ähnlichkeiten zum Auweter’schen „Maulkorb-Erlaß“
oder der Verweigerung der präsidialen Bestellung des gewählten geisteswissenschaftlichen
Dekans, Hans-Martin Gutmann in sein Amt im Sommersemester 2009 sind nicht zufällig.
Die elitäre, anti-demokratische Konzeption des berliner Hochschul-Präsidenten
macht sich besonders bemerkbar, indem er Studierenden prinzipiell die Mitbestimmungsfähigkeit
an Angelegenheiten, die nicht die Lehre betreffen abspricht:
„Wo ist studentische Mitbestimmung sinnvoll?
LENZEN: Wo es um die Lehre geht. In den Ausbildungsgremien der Fachbereiche und des Akademischen Senats haben die Studenten ja auch 50 Prozent der Sitze. In anderen Fragestellungen fehlt ihnen aber oft der nötige Einblick.“ (Furios, Studentisches Campusmagazin an der FU Berlin, 1. Juni 2009.)
Folgerichtig beabsichtigt Lenzen nicht, die berliner Studierenden an der auch
in der Bundeshauptstadt geplanten „Reform der Bologna-Reform“ zu
beteiligen.
Der Bewerber ist ungeeignet
„Grundordnung der Universität Hamburg - Präambel
Die Universität Hamburg als autonome öffentliche Körperschaft,
die im Zusammenwirken ihrer Mitglieder durch Forschung und Lehre, Studium und
Weiterbildung der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft dient, gibt sich in
eigenverantwortlicher Wahrnehmung ihres Satzungsrechts eine Grundordnung zur
Regelung der Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder, des Zusammenwirkens ihrer
Organe und Fakultäten sowie der Gestaltung ihrer Selbstverwaltung. Im Bewusstsein
der wechselvollen Geschichte und der gesellschaftlichen Verantwortung der Universität
bezieht sich der Akademische Senat dabei auf das am 15. Juni 1998 beschlossene
Leitbild der Universität als Auftrag zum Schutz und zur Verwirklichung
wissenschaftlicher Freiheit, zur Mitgestaltung eines sozialen und demokratischen
Rechtsstaates und einer friedlichen und menschenwürdigen Welt sowie zur
Verwirklichung des Rechtes auf Bildung und der Gleichstellung der Geschlechter.
Der Forschung, der Lehre und der Bildung gewidmet, sind die Universität
und ihre Fakultäten aufgerufen, den Zusammenhang der Universität zu
wahren und die wissenschaftliche Zusammenarbeit auch über Fächergrenzen
hinweg und im internationalen Austausch zu pflegen.“
(Amtl. Anz. Nr. 96, 8. Dezember 2006, S. 2952 bis 2959.)
Zur vertiefenden Lektüre empfohlen:
- Torsten Bultmann, Elite – Begabung – Exzellenz, Zur aktuellen Konjunktur einer anti-egalitaristischen Bildungspolitik, in: Lorenz Huck u.a. (Hg.), „Abstrakt negiert ist halb kapiert, Marburg 2008. [Link] [pdf]
- Bodo Zeuner, „Die Freie Universität Berlin vor dem Börsengang?“, Abschiedsvorlesung, Berlin 2007. [Link] [pdf]